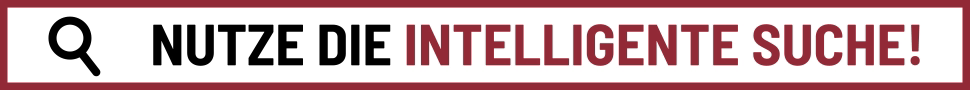Viele Bauherren unterschätzen, wie sehr die Finanzierung am Ende nicht vom Einkommen, sondern von Papieren abhängt. Das Grundstück ist gefunden, die Pläne sind gemacht, doch plötzlich hakt es: Die Bank wartet auf Unterlagen, die längst hätten vorliegen müssen. Für Bauherren bedeutet das oft Wochen der Verzögerung und steigende Nervosität. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob der Traum vom Eigenheim zügig Wirklichkeit wird.
Warum Banken exakte Nachweise zum Grundstück erwarten
Eine Bank prüft nicht nur das Einkommen des Kreditnehmers, sondern bewertet immer auch das Grundstück als Sicherheit für den Kredit. Dafür will sie schwarz auf weiß sehen, wie groß das Grundstück ist, wie es geschnitten ist und wo genau es liegt. Ohne diese Nachweise stoppt der Finanzierungsprozess sofort. Genau dafür ist die Flurkarte vorgesehen. Sie ist ein amtlicher Auszug aus dem Liegenschaftskataster und zeigt den Grenzverlauf, die Flurstücknummer sowie die Form des Grundstücks. Beantragt werden kann sie klassisch beim zuständigen Kataster- oder Vermessungsamt. Deutlich schneller geht es mittlerweile online – über Dienste wie Flurkarte24 lässt sich die benötigte Karte direkt bestellen und oft innerhalb weniger Tage herunterladen.
Welche Unterlagen zusätzlich auf den Tisch müssen
Zur Flurkarte gehört zwingend ein aktueller Grundbuchauszug. Darin steht, wer Eigentümer ist, ob bereits Grundschulden eingetragen sind oder ob Wegerechte bestehen. Banken prüfen dieses Dokument sehr genau, da es unmittelbar Einfluss auf den Beleihungswert hat. Ergänzend verlangen Kreditinstitute einen amtlichen Lageplan. In diesem wird sichtbar, wie das Grundstück zu Nachbarflächen liegt und wie es erschlossen ist, also ob Straßen- oder Versorgungsanschlüsse vorhanden sind. Erst die Kombination dieser drei Unterlagen – Flurkarte, Grundbuchauszug und Lageplan – gibt der Bank die Sicherheit, das Grundstück realistisch zu bewerten und die Höhe des Kredits festzulegen.
Flurkarte verstehen und richtig nutzen
Für viele Bauherren ist die Flurkarte nur ein weiteres Dokument, das auf der langen Liste der Bankunterlagen auftaucht. Tatsächlich ist sie jedoch zentral für die Finanzierung, weil sie das Grundstück eindeutig beschreibt. Sie ist ein amtlicher Auszug aus dem Liegenschaftskataster und enthält Informationen, die von Banken bei der Beleihungsprüfung genau analysiert werden. Wer die Inhalte versteht, kann Rückfragen vermeiden und tritt beim Finanzierungsgespräch souveräner auf.
Eine Flurkarte zeigt im Wesentlichen:
- Flurstücknummer: Eindeutige Kennung des Grundstücks. Jede Bank verlangt diese, um Grundstück und Grundbuch eindeutig zuordnen zu können.
- Grenzverlauf: Exakte Linien, die das Grundstück umschließen. Fehler beim Ablesen – etwa ein falscher Grenzverlauf – können später zu Streit mit Nachbarn führen.
- Nachbargrundstücke: Angaben zu angrenzenden Flächen sind relevant, weil mögliche Wegerechte oder Zufahrten die Nutzung beeinflussen.
- Maßstab und Größe: Die Karte wird meist im Maßstab 1:1000 oder 1:2000 erstellt. Bauherren sollten unbedingt prüfen, ob die Fläche mit den Angaben im Kaufvertrag übereinstimmt.
- Gebäude und Nutzungen: In vielen Fällen sind bereits vorhandene Gebäude eingezeichnet. Das kann für die Bank ein Hinweis sein, ob es sich um ein erschlossenes Grundstück handelt.
Worauf Bauherren achten sollten
Beim Lesen und Vorlegen der Flurkarte können kleine Fehler große Folgen haben:
- Immer aktuelle Version nutzen: Banken akzeptieren in der Regel nur Flurkarten, die nicht älter als ein Jahr sind. Ältere Auszüge führen zu Rückfragen.
- Grenzverlauf prüfen: Vor allem bei ländlichen Grundstücken ist es wichtig, dass keine Grenzüberschneidungen bestehen. Unsicherheit hier kann die Finanzierung verzögern.
- Zusammenhang mit Grundbuch herstellen: Flurkarte und Grundbuchauszug müssen in den Angaben deckungsgleich sein. Stimmen die Flurstücknummern nicht überein, lehnt die Bank den Vorgang ab.
- Zugänge und Wege beachten: Wenn das Grundstück keinen direkten Zugang zu einer öffentlichen Straße hat, muss ein Wegerecht eingetragen sein. Ohne diesen Nachweis kann die Bank den Kredit verweigern.
Grundbuchauszug
Neben der Flurkarte ist der Grundbuchauszug das zweite zentrale Dokument, das Banken bei der Baufinanzierung sehen wollen. Er ist die offizielle Bestätigung, wem das Grundstück gehört und ob es mit Rechten oder Belastungen versehen ist. Anders als die Flurkarte beschreibt er also nicht die Lage oder Form des Grundstücks, sondern die rechtlichen Verhältnisse.
Ein Grundbuchauszug enthält drei wichtige Abteilungen:
- Abteilung I: Eigentumsverhältnisse
Hier steht, wer als Eigentümer eingetragen ist. Für Bauherren ist es entscheidend, dass der Name mit dem Kaufvertrag übereinstimmt, sonst kann die Bank keine Sicherheit annehmen. - Abteilung II: Lasten und Beschränkungen
Dort finden sich Wegerechte, Wohnrechte oder Baulasten. Wer ein Grundstück kaufen will, muss genau prüfen, ob solche Rechte den Wert oder die Nutzung einschränken. - Abteilung III: Grundschulden und Hypotheken
Dieser Teil zeigt, ob bereits eine Finanzierung eingetragen ist. Eine noch bestehende Grundschuld muss gelöscht oder an die neue Bank abgetreten werden.
Viele Kreditnehmer übersehen, dass Banken in der Regel nur aktuelle Grundbuchauszüge akzeptieren. Ein Auszug sollte deshalb nicht älter als drei Monate sein. Beantragt wird er beim zuständigen Amtsgericht oder Grundbuchamt. Die Kosten liegen nach der bundesweiten Kostenordnung in Deutschland bei etwa 10 bis 20 Euro für einen einfachen und bei bis zu 40 Euro für einen beglaubigten Auszug (Quelle: Justizportal des Bundes und der Länder). Gerade der beglaubigte Auszug ist für Banken oft unverzichtbar, weil er die Echtheit der Angaben bestätigt. Fehler passieren häufig dann, wenn der Antrag nicht von der richtigen Person gestellt wird. Nur Eigentümer oder Käufer, die bereits einen notariellen Kaufvertragsentwurf vorweisen können, gelten als berechtigt. Ein weiteres Risiko sind veraltete Unterlagen, die von Banken sofort zurückgewiesen werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, beantragt den Auszug unmittelbar vor dem Finanzierungsantrag. Auch unklare Eintragungen im Grundbuch können zu Problemen führen. Alte Hypotheken oder eingetragene Rechte, deren Bedeutung nicht eindeutig ist, können eine Finanzierung verzögern oder ganz verhindern.
Lageplan
Während Flurkarte und Grundbuchauszug vor allem die rechtlichen und amtlichen Daten eines Grundstücks dokumentieren, liefert der Lageplan den räumlichen Überblick. Er zeigt, wie das Grundstück im Verhältnis zu Straßen, Nachbargrundstücken und bestehenden Gebäuden liegt. Für Banken ist er deshalb von großer Bedeutung, weil er sichtbar macht, ob ein Grundstück erschlossen ist, wie Zufahrtswege verlaufen und ob ausreichend Platz für die geplante Bebauung vorhanden ist.
Ein amtlicher Lageplan wird in der Regel von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder dem Katasteramt erstellt. Er enthält neben den Grenzen des Grundstücks auch topografische Informationen, vorhandene Bebauung und die Höhenlage. Für Bauherren ist es wichtig zu wissen, dass es zwei Varianten gibt: den einfachen Lageplan, der für die meisten Finanzierungs- und Kaufprozesse ausreicht, und den qualifizierten Lageplan, der zusätzlich von einem Vermessungsingenieur beglaubigt wird und insbesondere bei Bauanträgen erforderlich ist.
Worauf Bauherren achten sollten
Banken prüfen im Lageplan vor allem, ob das Grundstück über eine gesicherte Zufahrt verfügt. Ist keine direkte Anbindung an eine öffentliche Straße erkennbar, verlangen sie in der Regel ein nachgewiesenes Wegerecht. Auch die Frage, ob das Grundstück vollständig erschlossen ist, also Anschlüsse an Strom, Wasser und Abwasser bestehen, spielt eine Rolle. Diese Punkte können den Wert erheblich beeinflussen. Bauherren sollten den Lageplan daher sorgfältig lesen und mit den Angaben im Kaufvertrag abgleichen.
Für die Beantragung eines Lageplans müssen Eigentümer oder Käufer mit berechtigtem Interesse beim Kataster- oder Vermessungsamt einen Antrag stellen. Die Kosten variieren je nach Bundesland und Art des Plans, liegen aber meist zwischen 30 und 150 Euro. Wer einen qualifizierten Lageplan für den Bauantrag benötigt, muss in der Regel mit höheren Kosten rechnen, da die Arbeit eines Vermessungsingenieurs einbezogen wird.
Typische Stolperfallen im Umgang mit dem Lageplan
Ein häufiger Fehler ist es, nur einen älteren Lageplan vorzulegen. Banken verlangen aktuelle Unterlagen, weil sich Erschließung oder Nachbargrundstücke verändert haben könnten. Auch ein fehlendes Wegerecht wird oft übersehen, obwohl es die Nutzbarkeit massiv einschränkt. Wer unsicher ist, sollte den Lageplan mit einem Architekten oder Notar besprechen, um die Angaben richtig zu interpretieren.